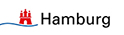Hamburg: Ein Anfang ist gemacht – es gibt noch viel zu tun!
 Foto: MoTo Bildsetzer
Foto: MoTo Bildsetzer
Vergiss nie dein Anfangsherz, sonst kehrst du zum Anfang zurück.
Zeami Motokiyo*
In den vergangenen vier Jahren bot das Kulturagentenprogramm allen fünf beteiligten Bundesländern den gleichen innovativen Entwicklungsrahmen. Jedoch gab es in jedem Land spezifische Rahmenbedingungen, welche die unterschiedlichen Entwicklungen beeinflussten. Ein Blick auf die vielfältigen Impulse, die das Programm in die Hamburger Stadtteilschulen bringen konnte, zeigt, dass viele Visionen von damals inzwischen tatsächlich Realität geworden sind. Dabei waren die Rahmenbedingungen in Hamburg besondere, denn eine gerade erst umgesetzte Schulreform brachte viele Herausforderungen mit sich – aber auch viele Chancen.
Wir als Landesbüro Hamburg möchten daher noch einmal einen Blick auf die Impulse werfen, die verknüpft sind mit dem Schultyp Stadtteilschule, ihrer Größe (1.000 bis über 1.600 Schülerinnen und Schüler, Kollegien mit bis zu 200 Lehrerinnen und Lehrern) und ihrer städtischen Lage. Der Schultyp „Stadtteilschule“ wurde nur ein Jahr vor dem Modellprogrammstart mit einer Schulreform in Hamburg eingeführt. Die Stadtteilschule ist eine Alternative zum Gymnasium und bietet alle Schulabschlüsse bis zum Abitur, das identisch mit dem Abschluss am Gymnasium ist. Der wichtigste Unterschied ist: In der Stadtteilschule lernen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam. Leistungsschwächere Kinder werden genauso wie Leistungsstärkere gezielt gefördert und gefordert.. Alle Kulturagentenschulen sind in Stadtteilen mit internationaler Schülerschaft verortet, viele liegen in zentrumsfernen Quartieren mit geringer kultureller Infrastruktur. Die Schulreform eröffnete mit der Einführung des neuen Schultyps „Stadtteilschule“ – in dem die Schülerinnen und Schüler alle Schulabschlüsse bis zum Abitur machen können – neue Bildungschancen.
Im Laufe des Modellprogramms zeichneten sich einige spezifische Entwicklungen ab, die durch die o.g. Herausforderungen geprägt sind und die sich auf folgende inhaltliche Themenfelder fokussieren lassen:
-
- Standortübergreifende Identitätsentwicklung durch Kultur
- Kulturbegriff einer internationalen Stadtgesellschaft
- Schule als Kulturinstitution
- Kooperation mit größeren Kulturinstitutionen
Stadtteilschulen, die beispielsweise aus verschiedenen Standorten bestehen, nutzten das Modellprogramm erfolgreich, um mithilfe standortübergreifender Veranstaltungs- oder Projektformate eine neue gemeinsame kulturelle Schulidentität zu entwickeln.
Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Kultur zum selbstverständlichen Bestandteil des Alltags von Kindern und Jugendlichen werden kann, hat in allen Schulen zum intensiven Nachdenken und Forschen über einen Kulturbegriff geführt. Interessanterweise zeichnete sich im Laufe der Jahre immer deutlicher ein erweiterter Kulturbegriff mit diversitäts- und ergebnisoffener Orientierung ab, der auch in den innovativen und konzeptionell anspruchsvollen Hamburger Kunstgeldprojekten seinen künstlerischen Ausdruck fand. Als hansestädtische Großstadt mit internationaler Stadtgesellschaft – Hamburg ist das Bundesland mit dem höchsten Anteil von Einwohnern mit Migrationsgeschichte – ist dies als ein Modellfall zu betrachten, den es weiter zu verfolgen, wenn nicht zu beforschen gilt.
Gerade in zentrumsfernen Stadtteilen mit schwacher kultureller Infrastruktur nahm die Vision einer „Schule als Kulturinstitution“ in den Kulturagentenschulen lebendige Gestalt an. Schulen wurden zu künstlerischen Produktionsorten, in denen Kultur den Stadtteil bereichert oder sie bespielen Orte mit Kultur und verschafften ihnen neues kulturelles Leben. Die Kooperation mit größeren, zentral gelegenen Kulturinstitutionen hat sich bei den Kunstgeldprojekten dieser Schulen als besonders wertvoll erwiesen. Allerdings zeigte sich, dass nicht nur die Schulen eine Prozessbegleitung zur Ausbildung tragfähiger Kooperationsstrukturen benötigen, sondern eigentlich auch z.B. die Museen, weil die Entwicklung innovativer Projekte oft über den Zuständigkeitsbereich der z.B. museumspädagogischen Vermittlung hinausgeht.
Jedoch nicht nur auf inhaltlicher Ebene lassen sich Entwicklungen ablesen. Das Landesbüro hat nach einer umfassenden Analyse jeder einzelnen Schule und ihrer Entwicklungsschritte herausgefunden, dass sich die Prozessbegleitung und Unterstützung der Kulturagentinnen und Kulturagenten noch stärker an den konkreten Zielen der Schulen orientieren und die vielfältigen Ressourcen (Kulturbeauftragte, Kulturagenten, Kunstgeld etc.) in bestimmten Bereichen bündeln ließe, beispielsweise durch
- - eine spezifische Unterstützung und Beratung in der Startphase für Schulen, die sich neu auf den Weg machen, ein kulturelles Profil zu entwickeln,
- - Konzentration auf ein größeres Projekt oder eine schulübergreifende Kulturveranstaltung für Schulen, die einen ausgewählten künstlerischen Schwerpunkt entwickeln möchten,
- - gezielte Weiterentwicklung der übergeordneten Strukturen für Schulen, die einen Kulturschwerpunkt im Leitbild der Schule, in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen, im Curricula etc. verankern möchten.
Darüber hinaus könnten für Modellschulen, die Kultur bereits erfolgreich in übergeordneten Strukturen verankert haben, passgenaue Entwicklungsrahmen geschaffen werden, die den Kulturschwerpunkt weiter qualifizieren und vor allem auch den Austausch mit anderen am Programm beteiligten Schulen vertiefen.
Die Spuren, die das Modellprogramm schon jetzt in Hamburg hinterlassen hat, sind unübersehbar, das Anfangsherz, d.h. die Motivation und Vision, mit der die Schulen, Fachbehörden und conecco in Hamburg angetreten sind, schlägt gerade wieder sehr laut, weil so Vieles, was man vor vier Jahren kaum zu hoffen wagte, heute in den Kulturagentenschulen Gestalt angenommen hat und sich immer mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter und noch mutigere, weitgehendere Visionen finden.
Nachsatz: Dass so viele Kinder und Jugendliche für Kultur begeistert werden konnten und sie aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken ist, das ist jedoch vor allem auch dem großartigen Engagement der Kulturbeauftragten und ihren unermüdlichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zu verdanken! Der Titel des Modellprogramms mag vielleicht manchmal dazu verleiten, die Kulturbeauftragten in den Schulen in ihrer zentralen Rolle und Funktion – die sie zumindest in Hamburg haben – aus dem Blick zu verlieren. Daher möchten wir an dieser Stelle nochmals unseren großen Dank und unsere Wertschätzung „unseren“ Kulturbeauftragten gegenüber ausdrücken.
* Zeami Motokiyo (1363 – 1443) war ein wichtiger Dramatiker, Theoretiker und Schauspieler des japanischen Nō-Theaters, der durch die Förderung des Shōguns Yoshimitsu eine – für diese Zeit nicht übliche – ausgezeichnete Bildung erhielt.

 Aktuelles
Aktuelles